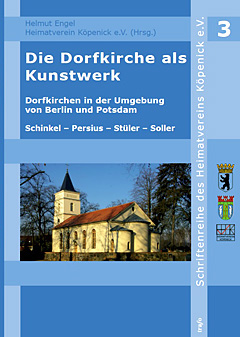Blaue Reihe | Schriftenreihe des Heimatvereins Köpenick e.V. | |
Band 1 | |
Von Copnic nach Köpenick - Ein Gang durch 800 Jahre Geschichte | |
Als am 10. Februar 1209 der Lausltzer Markgraf Konrad 11. eine Urkunde unterzeichnete, tauchte darin erstmals schriftlich der Ort "Copnic" auf. Diese Urkunde gilt als der Geburtstag für die Region, deren Name sich Im Laufe der Jahrhunderte veränderte: Von "Copnic" ging es nach Köpenick. 800 Jahre später ist dies eln Anlass, an die wechselvolle Geschichte der Stadt am Rande Berlins zu erinnem. Dieses Buch wirft Schlaglichter auf dle lange Geschichte Köpenicks. Köpenick hat mehr Geschichte zu bieten als wohl seine weltbekannteste: die des falschen Hauptmanns von Köpenlck, der 1906 die Stadtkasse beschlagnahmte. Da blickte Köpenlck schon auf sieben Jahrhunderte Geschichte seit der besagten Urkunde von 1209 zurück. Und Köpenick war über diese Jahrhunderte Anziehungspunkt für Siedler, Einwanderer, Zuzügler. Sie ließen sich von der wasserreichen Natur faszinieren und prägten den Ort bis heute. Burg, Schloss und Rathaus Köpenick sind Im Laufe der Zelt entstanden und sahen viel Freude, viel Leid. Ihre Geschichte und ihre Geschichten sind Themen in diesem Buch. Mehr als 30 Beiträge sind hier versammelt. Tradltionen wie der Köpenicker Grenzenzug werden ebenso beleuchtet wie die Geschichte der Waschfrauen und die Bedeutung von Wäldern, Natur und Sport für die Region. Gerade diese kleinen Geschichten zeigen, warum Köpenick lebens- und liebenswert ist. ISBN 978-3-89626-700-9 trafo Verlag 19,80 EUR | 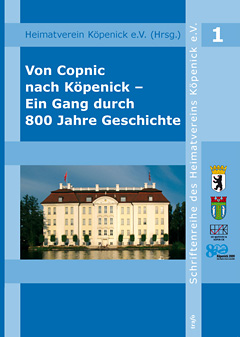 |
Band 2 | |
60 Jahre Joseph-Schmidt-Musikschule Treptow-Köpenick | Nachklang - Echo - Reflexion | |
Am 19. Februar 1951 begann in Köpenick die Geschichte der Musikschule. Sie gehörte damals zu einer der ersten Einrichtungen dieser Art in der DDR und wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einem Aushängeschild des Bezirks. Diese spannende Entwicklung in den vergangenen 60 Jahren wird in dieser Festschrift detailliert erzählt und ausführlich beleuchtet. Dabei wird auf die Schwierigkeiten und Probleme in den Anfangsjahren ebenso eingegangen wie auf musikalische Erfolge der Musikschüler und ihrer Lehrer. In ausführlichen Porträts werden zudem prägende Persönlichkeiten der Musikschulen in Köpenick und Treptow vorgestellt, ohne die eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Bildungseinrichtung nicht möglich gewesen wäre. Die Autoren werfen außerdem einen Blick auf die heutige Joseph-Schmidt- Musikschule, die seit der Bezirksfusion 2001 die ehemaligen Musikschulen Köpenick und Treptow mit ihren jeweiligen Schwerpunkten aufgenommen hat. Die Fachgruppenleiter kommen mit ihrem Lebenslauf und ihren Arbeitsschwerpunkten ebenfalls angemessen zu Wort. Porträts langjähriger Musikschüler, die ihre heutigen beruflichen Erfolge ihrer fundierten Ausbildung an der Musikschule verdanken, runden diese Publikation ab. Zudem wirft die Amtsleiterin für Bildung einen Blick in die Zukunft der Joseph-Schmidt-Musikschule, zeigt Probleme und Herausforderungen sowie deren Lösungen auf. Mit dieser Festschrift liegt erstmals eine Dokumentation der 60-jährigen Musikschularbeit in Treptow-Köpenick vor. ISBN 978-3-89626-970-6 trafo Verlag 17,80 EUR | 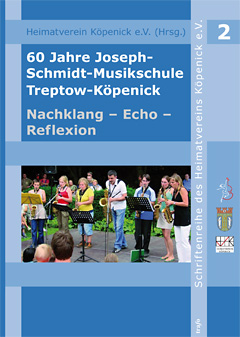 |
Band 3 | |
DIE DORFKIRCHE ALS KUNSTWERK Dorfkirchen in der Umgebung von Berlin und Potsdam | Schinkel – Persius – Stüler – Soller | |
Mit dieser Publikation liegt erstmals eine übergreifende Darstellung zum Dorfkirchenbau im Zeitraum von 1840 bis 1850 im räumlichen Umfeld von Berlin und Potsdam vor. Entwicklung als Veränderung vollzog sich in diesem Jahrzehnt von der Mitte des 19. Jahrhunderts an zunächst als bewusster Bruch mit der Vergangenheit, der im Bereich der Architektur nur vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte erklärt werden kann: durch den Übergang in der Herrschaft von Friedrich Wilhelm III. auf Friedrich Wilhelm IV. im Jahr 1840, durch den Tod Schinkels als Leiter der preußischen Oberbaudeputation 1841 und durch den Versuch, gegen die Kirchenferne der Untertanen durch verstärkte Anstrengungen im Bau von Gotteshäusern anzugehen. Der Typus der von Schinkel 1827 in königlichem Auftrag entworfenen „Normalkirche“ galt nicht mehr. Mit den Kirchen in unseren märkischen Gefilden hat sich noch nie jemand in dieser Ausführlichkeit befasst, wie sie nun als Überblicksdarstellung durch den Kunsthistoriker Helmut Engel vorgelegt wird. Er hat bereits mit seinem 2011 erschienenen Buch über die kirchliche Bautätigkeit in Charlottenburg ein wegweisendes Buch für diesen Innenstadtbezirk vorgelegt, in dem die Hauptkirchen und ihre architektonischen Merkmale treffend und verständlich beschrieben werden. ISBN 978-3-86465-026-0 trafo Verlag 25,80 EUR |
|
Direkt zum Seiteninhalt
Zurück zum Seiteninhalt